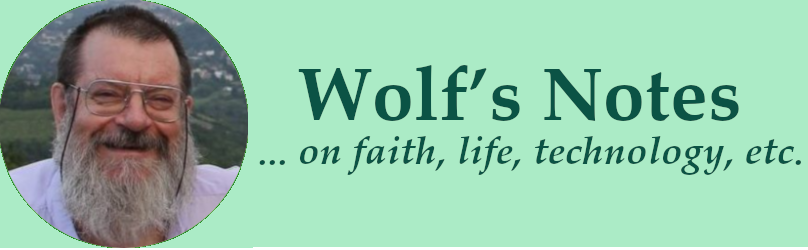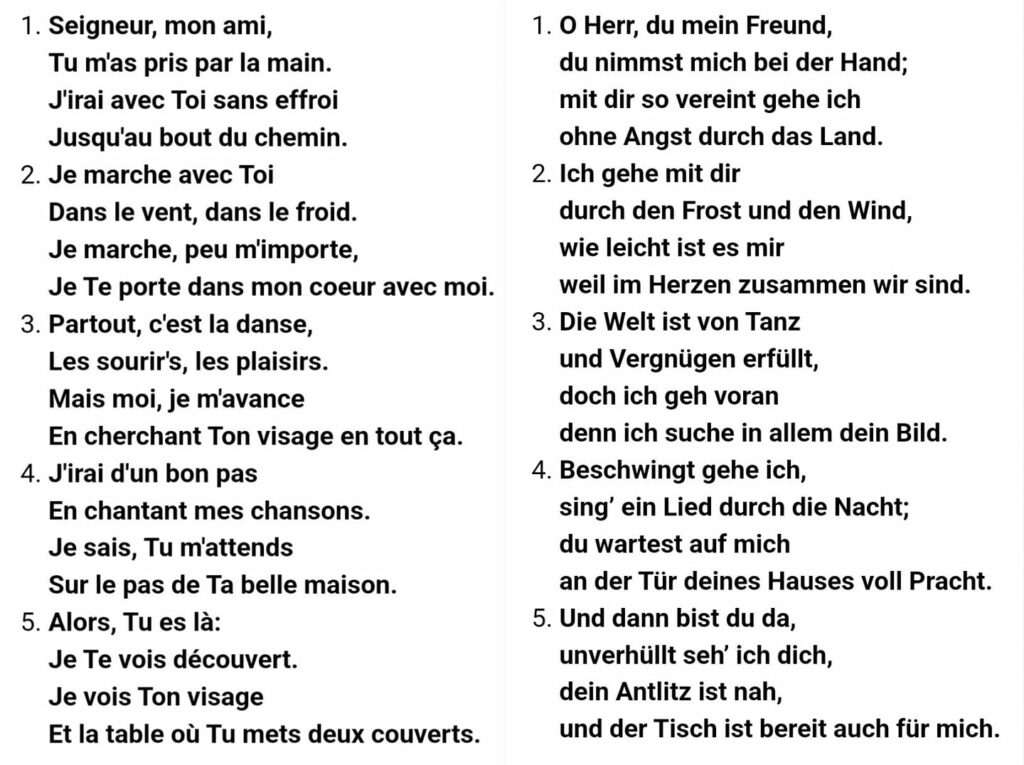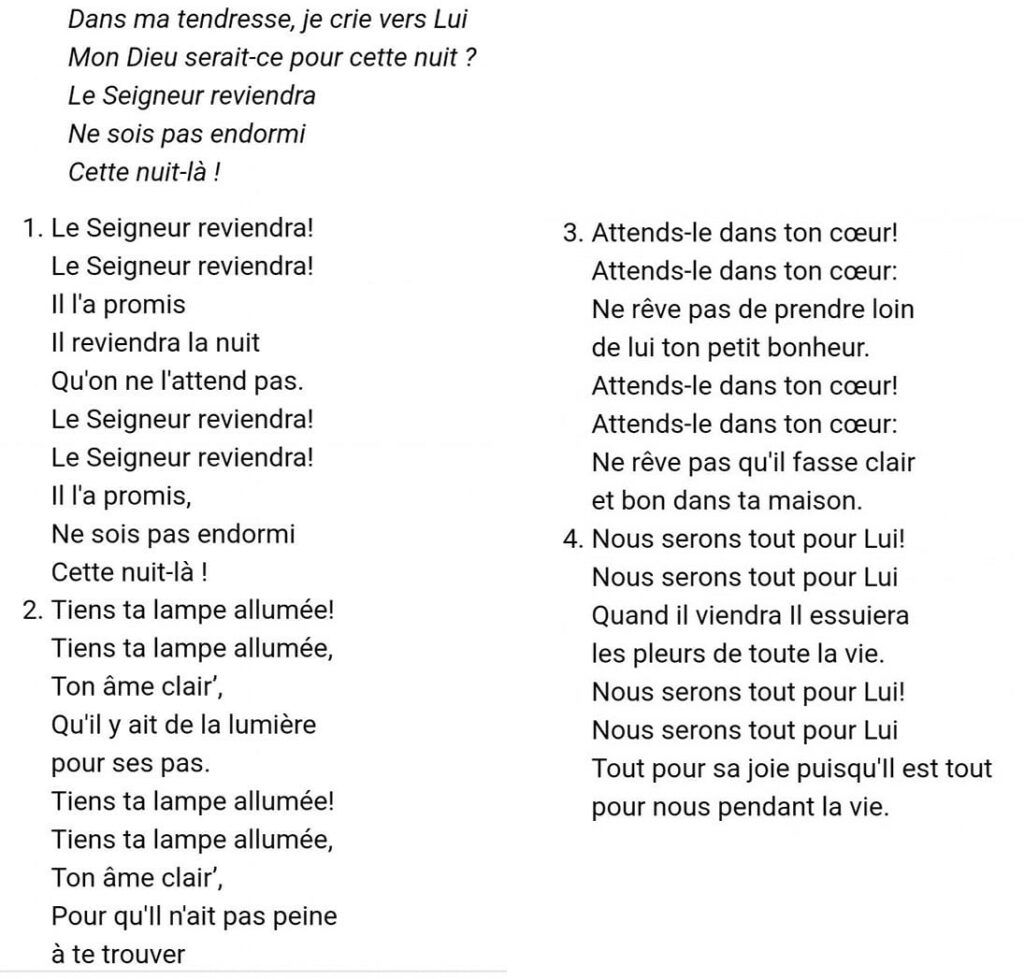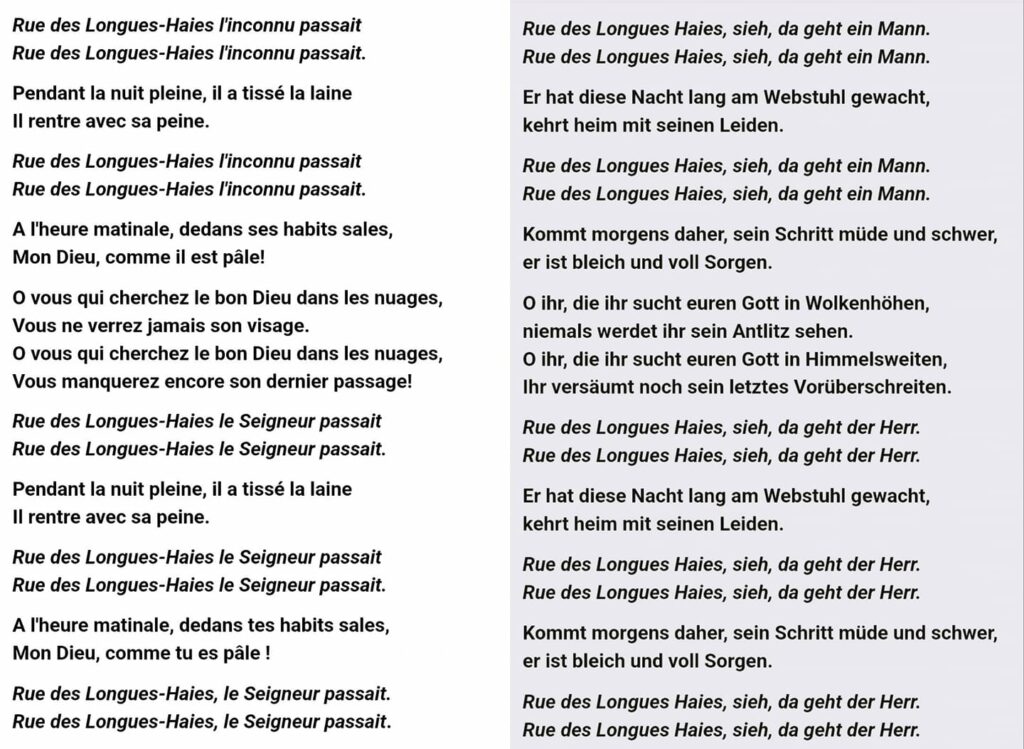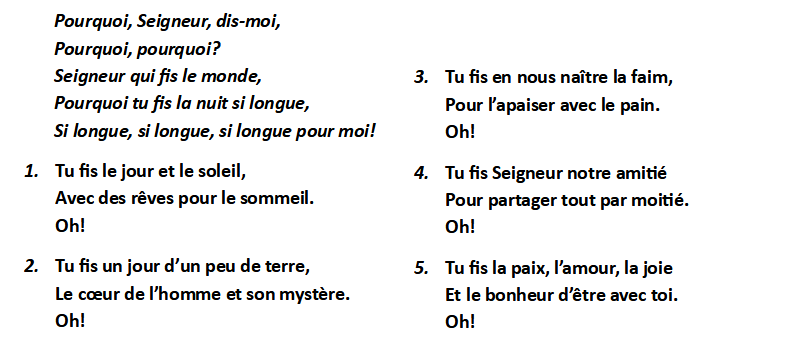Schwierige Koalitionsverhandlungen in NÖ
Die neue profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer schreibt in der heutigen heutigen “profil Morgenpost” über das Scheitern der schwarz-ropten Koalitionsverhandlungen in Niederösterreich.
Angeblich hat noch-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die SPÖ-Forderungen (kostenlose Ganztagsbetreuung im Kindergarten, Ausweitung eines Pilotprojekts zur Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, Heizpreisstopp für Haushalte, Anstellungsmodell für pflegende Angehörige, sowie eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen) als “weitgehend standortgefährdend” bezeichnet.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn sie gesagt hättee, “Das können wir uns nicht leisten“, hätte ich das verstanden; aber “standortgefährdend“? Im Gegenteil, gerade in einer Zeit wo viele Firmen große Probleme haben, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten, würden Maßnahmen, die das Land für die Menschen attraktiver machen, es auch als Standort für Firmen attraktiver machen.
Jetzt führt die ÖVP Koalitionsgespräche mit der FPÖ, und ein Erfolg dieser Gespräche wäre wirklich standortgefährdend.
Aber ein ganz großes und wesentliches Problem der ÖVP ist die innere Zerissenheit. Die Bünde, in die die Partei gegliedert ist, vor allem Bauernbund, ÖAAB, und Wirtschaftsbund, funktionieren fast wie separate Parteien, mit teilweise sehr unterschiedlichen Interessen. Man könnte sagen, die ÖVP ist selbst eine Koalition, und tut sich als solche nicht gerade leicht bei Koalitionsverhandlungen mit anderen. Das, was früher die ÖVP-Teilorganisationen verbunden hat, nämlich das christliche (katholische) Welt- und Menschenbild, verliert in der Politik immer mehr an Bedeutung, und damit wird der Zusammenhalt der Bünde immer schwächer.