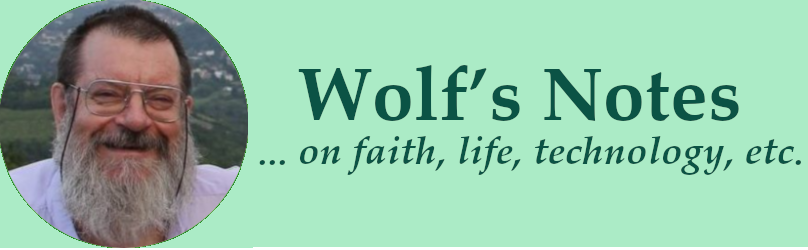(Aktualisiert: Heute, Freitag, 23. Dezember, ist die siebente (und letzte) der „O-Antiphonen“ dran, O Immanuel. Videos am Ende dieses Posts.)
- Heute, Samstag, 17. Dezember, beginnt die Woche der „O-Antiphonen“, sieben Leitversen als Antiphonen zum Lobgesang der Maria, dem Magnificat, in der Vesper, dem liturgischen Abendgebet, in mehreren christlichen Traditionen. Seit dem 7. Jahrhundert wird in der Vesper, dem liturgischen Abendgebet, das Magnifikat, der Lobgesang der Maria, gebetet oder gesungen; an den sieben Tagen vor dem Heiligen Abend jeweils mit einer von sieben Antiphonen, die alle mit dem Ausruf “O” beginnen. Sie sprechen den Messias mit einem Titel an, mit dem Er im Älteren Testamentbeschrieben wird, preisen Ihn für Sein Wirken, und enden mit der Bitte, “Komm!”:
1. O Weisheit …
2. O Adonai …
3. O Sproß aus Jesses Wurzel …
4. O Schlüssel Davids …
5. O Morgenstern …
6. O König der Völker …
7. O Immanuel
Die O-Antiphonen „sollen uns anleiten, darüber nachzudenken, wer dieser Jesus für mich ist. Wir wollen unser Herz weit machen, dass wir das Fest seiner Geburt freudig feiern können.“ So heißt es auf der Seite „praedica.de“, wo die vollständigen Texte der O-Antphonen sowie weiterführende Gedanken zu finden sind. Das ist eine katholische Seite, aber die O-Antiphonen sind auch Teil der Vesper in den anglikanischen und lutherischen Traditionen. Der evangelische Pfarrer Detlef Korsen hat auf seinem YouTube Kanal eine kurze Einleitung dazu veröffentlicht und möchte zu jeder der Antiphonen ein Video veröffentlichen:
17. Dezember — O Sapientia — O Weisheit
Gedanken zu “O Weisheit” von Pfarrer Detlef Korsen
Magnifikat mit O Weisheit, gesungen von Pfarrer Korsen
18. Dezember – O Adonai – O Adonai (O Herr)
Gedanken zu “O Adonai” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O Adonai, gesungen von Pfarrer Korsen
19. Dezember – O Radix Jesse– O Sproß aus Jesses Wurzel
Gedanken zu “O Sproß aus Jesses Wurzel” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O Sproß aus Jesses Wurzel, gesungen von Pfarrer Korsen
20. Dezember – O Radix David– O Schlüssel Davids
Gedanken zu “O Schlüssel Davids” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O Schlüssel Davids, gesungen von Pfarrer Korsen
21. Dezember – O Oriens – O Morgenstern
Gedanken zu “O Morgenstern” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O Morgenstern, gesungen von Pfarrer Korsen
22. Dezember – O Rex Gentium – O König der Völker
Gedanken zu “O König der Völker” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O König der Völker, gesungen von Pfarrer Korsen
23. Dezember – O Immanuel
Gedanken zu “O Immanuel” von Pfarrer Korsen
Magnifikat mit O Immanuel, gesungen von Pfarrer Korsen
__________